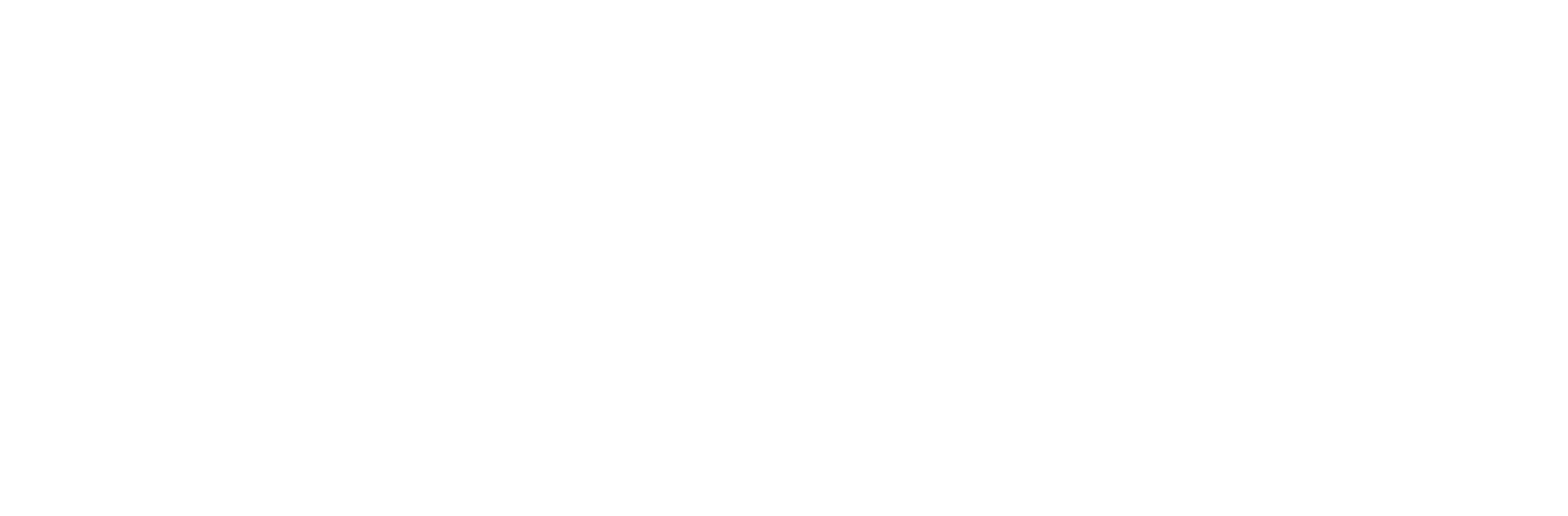Abtreibung im Film: Der Streit ums Leben und leben lassen
Aus gegebenem Anlass präsentieren wir unsere cineastischen Empfehlungen rund um ein Thema, das seit Jahrzehnten Politik und Gesellschaft spaltet. Euch erwarten vielschichtige Protagonistinnen, ungewohnte Perspektiven und gewichtige Entscheidungen.

4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage (Cristian Mungiu, 2007)
Die Atmosphäre in 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage ist von der ersten Sekunde an intensiv und fordernd - und dennoch bereitet nichts darauf vor, was im Verlauf dieses rumänischen Spielfilms über einen hereinbrechen wird. Das liegt vor allem daran, dass die atmosphärische Wirkung zunächst gar nicht von dessen eigentlichem Kernthema herrührt, sondern von seiner komplexen zeitgeschichtlichen Verortung und einnehmenden filmischen Inszenierung. So wird über weite Teile der ersten Filmhälfte die Thematik eines Schwangerschaftsabbruchs gar nicht offensichtlich verhandelt, zumindest nicht direkt benannt. Der Regisseur Cristian Mungiu wirft seine Zuschauer:innen unmittelbar in das erzählte Geschehen im Rumänien von 1987 hinein, ausgiebige Kameraeinstellungen, überwiegend aus der Hand gedreht, verfolgen die beiden Protagonistinnen Otilia (Anamaria Marinca) und Găbița (Laura Vasiliu) bei geschäftigen Vorbereitungen. Sie sind im Aufbruch begriffen, doch worauf genau sie sich vorbereiten, wird erst schrittweise offenbart. Es handelt sich um zwei junge Frauen, welche sich ein Zimmer in einem studentischen Wohnheim teilen und dadurch irgendwie auch ihr Leben. Sie sind in eine beengte Umgebung eingebunden: Viele Menschen leben in dem Wohnheim auf engem Raum zusammen und scheinen keine Distanz zwischen sich zu kennen. Die unruhige, aber keineswegs hektische Kamera folgt Otilia auf ihrem Weg durch das Gebäude, sie unterhält sich mit anderen jungen Frauen in der Gemeinschaftsdusche, selbst vollständig angezogen, und erwirbt ein paar Dinge bei einem Mitstudierenden, dessen Zimmer eine Art kleiner Schwarzmarkt ist. Schnell wird klar, dass bestimmte Waren knapp sind, nur selten gibt es die gewünschte Seifen- oder Zigarettenmarke. Ein weiterer Faktor, der das Leben von Otilia und Găbița bestimmt und durch den Film in den Fokus genommen wird, ist ihre soziale Rahmung. Wiederholt wird thematisiert, dass sie eigentlich Fremdkörper sind in dieser studentischen Großstadt, da sie ursprünglich aus einer ländlichen Gegend und bäuerlichen Verhältnissen stammen. Dieser Umstand schweißt die beiden gewissermaßen zusammen, macht sie jedoch auch noch mehr zum Ziel für jene Art von Gefahren, Diskriminierung und Misshandlung, denen sie sich im Laufe der Handlung ausgesetzt sehen.

Es ist eine große Stärke von 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage, dass darin der lebensverändernde Vorgang einer Abtreibung nicht einfach nur für sich verhandelt wird, sondern vielmehr als ein Ereignis, welches in unzählige komplexe Rahmenbedingungen gebettet und durch ebenso viele soziohistorische Faktoren beeinflusst wird. Der Fakt, dass ein Schwangerschaftsabbruch im Rumänien von 1987 eine Handlung ist, die nicht offiziell geschehen darf, sondern in der heimlichen Illegalität passieren muss, unter Androhung drakonischer Gefängnisstrafen und gesellschaftlicher Ächtung, ist nur eine dieser Rahmenbedingungen. Denn selbst innerhalb dieser ohnehin prekären Situation tun sich noch einmal weitere Abstufungen der Prekarität auf. Es wird sich zeigen, dass Otilia und Găbița auf dieser Stufenleiter ziemlich weit unten stehen. Sie wissen aufgrund ihrer ländlichen Herkunft nichts über Möglichkeiten, eine inoffizielle Abtreibung durchzuführen, ohne sich dabei selbst seelisch und körperlich in Gefahr zu bringen. Aufgrund dieser Unwissenheit begeben sie sich in die Hände von Menschen, die ihre hilflose Situation zum eigenen Nutzen missbrauchen werden. Eine weitere Stärke dieses Films ist seine ungewöhnliche Erzählperspektive, die er konsequent wählt und bis zum Ende durchzieht. Es ist vor allem die Perspektive von Otilia, welche einen Großteil des Films bestimmt. Sie selbst ist nicht schwanger, es ist Găbița, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen will oder muss oder beides. Otilia scheint zunächst nur die Rolle der guten Freundin einzunehmen, welche Găbița dabei hilft, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Sie macht nicht nur letzte Besorgungen für sie, sie organisiert auch händeringend ein Hotelzimmer und übernimmt das erste Treffen mit der Person, die die Abtreibung dort durchführen wird - alles Dinge, die eigentlich Găbița übernehmen sollte. Dass diese sich davor drückt, liegt an ihrer seltsam naiven Art, die Dinge geschehen zu lassen und sich auf die Hilfe anderer zu verlassen, ohne sich dabei der Konsequenzen für sich und ihrer Umgebung bewusst zu sein. Otilia muss deshalb immer wieder all die Versäumnisse und Fehlentscheidungen ihrer Mitbewohnerin ausbügeln, um sie vor schlimmeren Dingen zu bewahren. Eigentlich "müsste" Otilia keine dieser Dinge tun, schließlich liegen diese in Găbițas Verantwortung. Sie tut sie dennoch, zunächst weil Găbița ihre Freundin ist und ohne Hilfe scheinbar aufgeschmissen wäre. Aber über den Verlauf des Films ändern sich Otilias Beweggründe für ihre Handlungen, von einem rein freundschaftlichen Mitgefühl hin zu einem Bewusstsein dafür, dass sie selbst sich genauso schnell in Găbițas Situation befinden könnte, hin zu einem Bewusstsein über ihre Situation als Frau, die durch eine ungewollte Schwangerschaft jederzeit gesellschaftlich in die Illegalität gedrängt werden könnte. Und so ergibt es einen tieferen Sinn, dass Otilia und Găbița in der abschließenden Szene des Films und nach Durchleben schrecklicher Ereignisse zusammensitzen, abgeschottet von allen anderen Menschen um sich herum, nur auf einander gestellt, ohne jemals über das Erlebte mit jemand anderem sprechen zu können, aber gerade aus dieser verschworenen Zweiergemeinschaft ihre Stärke ziehend.
Was der Film 4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage zeigt, ist mitunter schwer anzuschauen. In zurückgenommenen, aber mit einem detaillierten Blick inszenierten Szenen führt uns der Regisseur Cristian Mungiu durch einen Abgrund. Schleichend geraten die zwei Hauptfiguren in die Fänge ihrer soziokulturellen Situation – kämpfen sich aber auch wieder heraus. Genaue Beobachtungen zwischenmenschlicher Interaktionen und komplexer Zusammenhänge ziehen sich durch den gesamten Film und machen ihn so sehenswert. Was auf den ersten Blick wie ein schlichter Versuch des filmischen "Realismus" erscheinen mag, entblößt schon beim zweiten Blick eine derartige Vielschichtigkeit, dass ein vielfaches Hinschauen unabdingbar wird.
Das Ereignis (Audrey Diwan, 2021)
Die Tatsache, dass so viele herausragende Filme, welche sich mit Abtreibung beschäftigen, aus Frankreich stammen, lässt darauf schließen, dass dieses Thema die dortige Bevölkerung sehr beschäftigt. Allein in den vergangenen Jahren findet sich die Thematik u.a. bei Porträt einer jungen Frau in Flammen, oder beim letztjährigen Cannes-Gewinner Titane. Letzterer, ein eigenwilliger Mix aus Außenseiterporträt und Body Horror, Genrefilm und Arthauskino, wurde schließlich auch für die Oscars eingereicht. Ein aussichtsloses Unterfangen, die Oscars sind schließlich nicht gerade dafür bekannt, offen gegenüber weirden und abseitigen Filmen zu sein. Da hätte Frankreich mit Das Ereignis, der ebenfalls in der Vorauswahl war, deutlich bessere Chancen gehabt.
Das Abtreibungsdrama, welches 2021 den Goldenen Löwen der Filmfestspiele Venedig gewann, spielt im Frankreich des Jahres 1963 und handelt von der Literaturstudentin Anne, welche ungeplant schwanger wird. Für die junge Frau kommt nicht in Frage, das Kind auszutragen und damit ihre Zukunft zu opfern ("Ich möchte ein Kind, aber nicht auf Kosten meines Lebens.") und so steht ihr Entschluss, die Schwangerschaft zu beenden von Anfang an fest. Im Frankreich der 60er jedoch ein schwieriges und gefährliches Unterfangen. Personen, welche Abtreibungen durchführen sowie den Schwangeren droht die Gefängnisstrafe, weswegen Abtreibungen im Geheimen und unter riskanten Bedingungen durchgeführt werden. Da es keine einfache Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch gibt, gilt eine Schwangerschaft unter den Studentinnen als größtmögliches Übel ("Die Krankheit, welche nur Frauen trifft und sie zu Hausfrauen macht."). Eine Person zu finden, welche eine Abtreibung durchführt, ist Anne beinahe unmöglich. Zudem reagiert Annes Umfeld sehr abweisend, denn die unverheiratete junge Anne, welche abtreiben möchte, passt überhaupt nicht in das konservative Weltbild des damaligen Frankreichs.

Obwohl der Film in den frühen 60ern angesiedelt ist, gibt es wenige Indizien, anhand welcher sich der Film zeitlich eindeutig verorten lässt. Gut, in den Tanzlokalen läuft etwas andere Musik als heutzutage und die männlichen Studenten tragen Koteletten, aber Regisseurin Audrey Diwan verzichtet soweit wie möglich auf Zeitkolorit. Bezüge auf die politische Situation der Zeit oder pittoreske Stadtszenen mit Oldtimern sind hier also nicht zu finden. Ganz klar eine bewusste Entscheidung, schließlich beschäftigt das Thema auch heutzutage noch viele Menschen. Und leider sind Todesfälle durch repressive Abtreibungspolitik immer noch kein Ding der Vergangenheit.
Besonders auffallend an Das Ereignis ist der visuelle Stil. Durch das 4:3-Format und die geringe Schärfentiefe sind die Bilder extrem auf die Protagonistin fokussiert, welche oft von ihrer Umgebung isoliert wirkt. Die dynamische Handkamera folgt Anne, welche in beinahe jeder Einstellung des Filmes zu sehen ist, aus nächster Nähe. Inhaltlich ist der Film zwar recht geradlinig und folgt nüchtern der Protagonistin von Bekanntwerden der Schwangerschaft bis zum Schwangerschaftsabbruch, aber das hervorragende Schauspiel von Hauptdarstellerin Anamaria Vartolomei, die starke Inszenierung und die große Nähe zur Hauptfigur machen Das Ereignis zu einer eindrucksvollen Erfahrung. Die eigentliche Abtreibung wird schließlich als One-Take präsentiert und ist in ihrer Ausführlichkeit sehr intensiv und schwer anzusehen.
Neben dem Abtreibungsthema hat der Film übrigens noch eine weitere Gemeinsamkeit mit Porträt einer jungen Frau in Flammen: Die französisch-kosovarische Darstellerin Luàna Bajrami, welche dort die junge Frau spielte, die ihre Schwangerschaft beenden möchte, spielt hier eine der Freundinnen der Protagonistin. Das Ereignis startete am 31. März 2022 in den deutschen Kinos und wird voraussichtlich am 22. September auf Blu-ray erscheinen.
I Will Forget This Day (Alina Rudnitskaya, 2010)
Eine entfernte Brücke im Winter, eine befragte Frau fängt an zu weinen, ein Stuhl in einem Krankenhausgang auf dem die Frau alleine sitzt. Über einen Spiegel blicken wir nach und nach in die gedankenversunkenen Gesichter vieler Frauen. Scheinbar endlos wirken diese Augenblicke der Betrachtung, doch plötzlich stehen sie auf und gehen durch eine Tür.
Der Kurzfilm I Will Forget This Day (Я забуду этот день) von Alina Rudnitskaya dokumentiert, in analogen Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die letzten Wartemomente vor dem Schwangerschaftsabbruch in einer russischen Abtreibungsklinik. Die eigentliche Thematik lässt der Film selber allerdings lange Zeit offen und man fragt sich, was mit diesen Frauen im Operationssaal gemacht wurde, da sie nach einer Weile wie reglose Körper auf Rolltragen aus dem Raum geschoben werden. Es wirkt wie der letzte Weg ins Leichenhaus. Kaum ist eine Frau weggeschoben, darf die Nächste eintreten. Diese Unausgesprochenheit zieht die Zuschauenden in einen niederschmetternden Sog, da man sich fragt, was die Frauen dazu treibt. Durch die Gesichter der Frauen schaut man in ihr Inneres. Erst spät offenbart der Film durch einige Aufklärungsgespräche die eigentliche Abtreibungsthematik. Es sind bittere Lebensumstände, die von den Frauen geschildert werden und man versteht endgültig, warum sie diese Entscheidung getroffen haben. Noch härter treffen die Sätze der Ärztin, die einer jungen Frau erklärt, ihr Fötus sei schon zu alt für einen Schwangerschaftsabbruch und warum sie denn nicht schon früher gekommen sei.

Der Fokus der Kamera liegt dabei immer auf den Frauen, Ärzte und Helferinnen treten in den Hintergrund und werden teilweise bewusst aus dem Bild gelassen. Generell ist der Kurzfilm sehr minimalistisch gefilmt mit meist langen, statischen Kameraeinstellungen, welche durch dumpfe metallene Klänge aus der Klinik ergänzt werden. Das schwarz-weiße Filmbild ist außerdem absichtlich verkleinert, was eine Art Tunnelblick erzeugt. Die Schwere und Tragweite der Abtreibungsentscheidung wird spürbar auf die Zuschauenden übertragen. Alina Rudnitskaya schafft es einsdrucksvoll mit dem Blick von Außen, das Innenleben der gezeigten Frauen offenzulegen. Auch in ihren anderen Filmen beschäftigt sich die Regisseurin mit der Rolle der Frau im modernen Russland.
In I Will Forget This Day realisiert man auf bedrückende Art, dass der titelgebende Wunsch des Vergessens nicht eintreten wird, zu einschneidend werden die beklemmenden Erinnerungen sein. Der Film lässt die Zuschauer:innen an diesen letzten Wartemomenten teilhaben und sie bleiben dadurch auch ein Teil von ihnen.