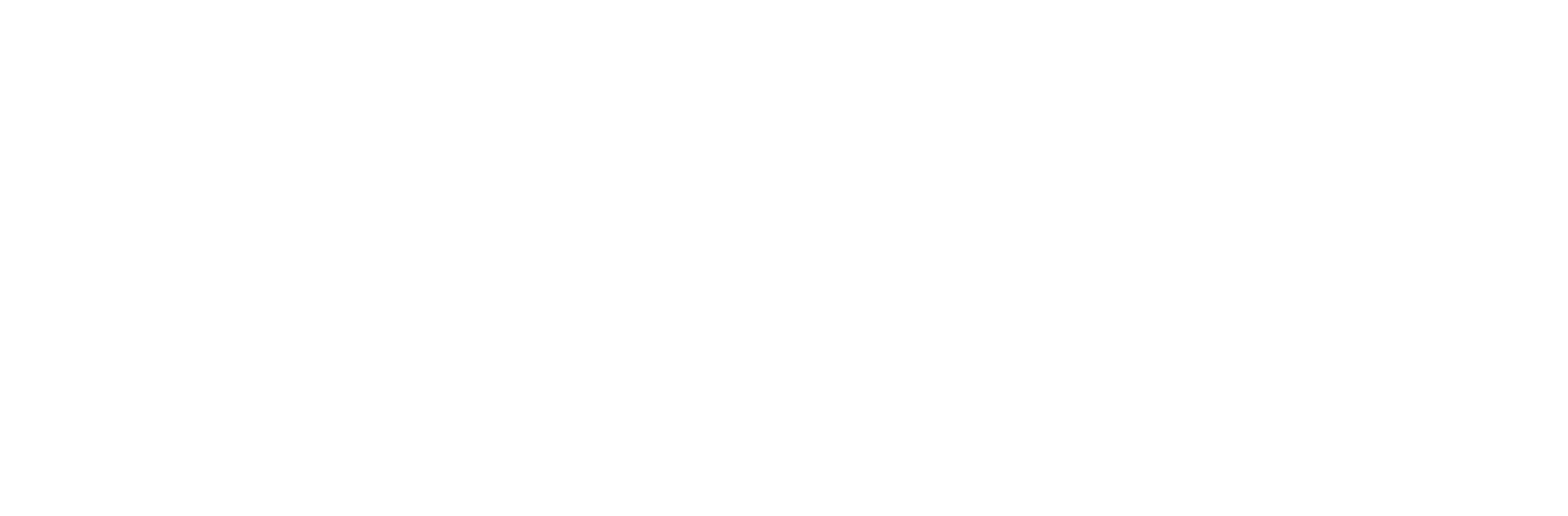Unsere Lieblingsfilme 2024
We're back! Und falls ihr euch immer noch fragt, was wir 2024 geliebt haben - fragt euch no more, lest einfach.

The Holdovers (Lukas)
Bei meinem Lieblingsfilm 2024 werdet ihr gleich möglicherweise fragen: "Hä, ist der nicht schon uralt?" Ja, es stimmt. The Holdovers von Alexander Payne ist streng genommen ein Film von 2023, aber da er in Deutschland erst im Januar 2024 erschienen ist, habe ich es mir erlaubt, dieses wundervolle Kleinod als meinen Lieblingfilm des vergangenen Jahres auszuwählen. Ich hoffe, ihr mögt es mir verzeihen. Doch bevor wir zu dem Film selbst kommen, erlaube ich mir kurz die Frage zu stellen, wie denn das vergangene Kinojahr im Allgemeinen war? Meiner Meinung nach eigentlich ok, aber etwas arm an echten Highlights. Die Mehrheit meiner Lieblingsfilme waren entweder Nachzügler von 2023, die Anfang des letzten Jahres ihren Weg nach Deutschland gefunden haben (wie Der Junge und der Reiher, The Holdovers, The Zone of Interest und All of Us Strangers) oder sind dann erst 2025 bei uns erschienen (wie Oslo-Stories: Träume, Nickel Boys, Queer, Soundtrack of a Coup d'Etat, Sing Sing und Kneecap) und gehören damit nicht in diesen Artikel. Doch auch wenn diesem Jahr ein "Barbenheimer"-Spektakel gefehlt hat, gab es ein paar Highlights, die nicht unerwähnt bleiben sollten, wie Dune: Part Two (einer der bildstärksten Sci-Fi-Blockbuster, die ich je erlebt habe), Furiosa (kein Meisterwerk, aber ich habe den wilden Action-Zirkus doch sehr genossen), Anora (zurecht Oscar-prämiert), Der wilde Roboter und Wicked (beides Filme, bei denen ich geheult habe ❤️).
Doch zurück zu The Holdovers. Ich freue mich zwar, dass wir diesen Artikel nach längerer Blogpause endlich veröffentlichen, aber etwas schade ist es dennoch, dass er erst jetzt, im Frühling, erscheint. Denn The Holdovers ist einer der schönsten Weihnachtsfilme, die ich seit langem gesehen habe. Alexander Payne, bekannt u.a. für Election, Sideways und Nebraska präsentiert uns eine anrührende Geschichte über den grantigen Geschichtslehrer Mr. Hunham (famos verkörpert durch Paul Giamatti), der über die Feiertage in einem Internat in Massachusetts auf den stürmischen Teenager Angus (Dominic Sessa) aufpassen muss, dessen Mutter und Stiefvater ihn versetzt haben, um in die Flitterwochen zu fahren. Was folgt ist wenig überraschend: Am Anfang sind sich die beiden spinnefeind, im Verlauf des Filmes nähert man sich behutsam aneinander an, entdeckt Gemeinsamkeiten und findet heraus, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat. Mit von der Partie ist dann noch die taffe Schulköchin Mary (ebenfalls zurecht Oscar-prämiert: Da'Vine Joy Randolph), die kürzlich erst ihren einzigen Sohn im Vietnamkrieg verloren hat.
Wir befinden uns nämlich im Jahr 1970. Und genauso fühlt sich der Film auch an: Eine wunderschön altmodische Tragikomödie im New-Hollywood-Gewand, wie sie damals auch ein Hal Ashby hätte drehen können. Ruhig und unaufgeregt erzählt, mit authentischer Ausstattung, eleganten Bildern, die trotz Digitalkamera den Look der 70er verblüffend gut imitieren, und einem stimmungsvollen Soundtrack mit einer Mischung aus Weihnachtsliedern und zeitgenössichen Folk- und Rocksongs (u.a. von Cat Stevens). Ich war ab der ersten Minute sofort verzaubert von der leicht melancholischen Stimmung, der Musik, den neuenglischen Backsteingebäuden in weißgepuderter Winterlandschaft. Und natürlich von den Charakteren. Mr. Hunham, Angus und Mary sind einfach so ein starkes Trio und es ist eine wahre Freude mitzuerleben, wie diese grundverschiedenen Menschen sich nach und nach anfreunden. Und wenn man dann beim bittersüßen Ende angelangt ist, hat man die Figuren so in sein Herz geschlossen, dass kaum ein Auge trocken bleiben wird. The Holdovers ist ein herrlich unkitschiger Weihnachtsfilm, der selbst Feiertagsmuffeln gefallen wird. Mein Lieblingsfilm des Jahres und ein Film, der bestimmt seinen Weg in meine alljährliche Weihnachts-Watchlist finden wird.
Der wilde Roboter (Emely)
Ein Roboter, der an die Küste einer Insel gespült wird, ist nach seiner Aktivierung damit beschäftigt, seine Aufgabe zu finden. Trotz mehrfachen Angriffen von Tieren versucht der Roboter erst noch sich anzugliedern und die Sprache der Tiere zu lernen, muss aber schnell feststellen, dass er nicht willkommen ist. Schon am Aufgeben, versucht er ein Abholsignal zu senden und da gerät er auch schon in den nächsten Schlamassel. Durch einen Unfall ist er nun an ein Gänseküken gebunden – endlich eine Aufgabe für ihn!
Begleitet wird die ganze Geschichte von einer wunderschönen, fluiden Animation, die atemberaubende Bilder von Herden und Wäldern zeigt. Am besten auf der großen Leinwand zu genießen, solange es noch geht! Das Ganze wird zudem durch sehr durchmischte Charaktere und eine wunderbaren Message unterstützt.
Ich möchte auch gar nicht so viele Worte dazu verlieren, da ich jedem nur empfehlen kann, sich diesen Film unbedingt anzuschauen. Dreamworks Animationen werden leider sehr oft übersehen, da sie in Disneys Schatten stehen, aber ich kann euch versichern, dass dieser Film mehr Seele besitzt als die letzten Filme, die von dem Maus-Konzern kamen.
Die Saat des heiligen Feigenbaums (Dana)
Frau, Leben, Freiheit.
Am 13. September 2022 wird Jina Mahsa Amini von der iranischen Polizei auf offener Straße geschlagen, misshandelt und mit Gewalt gezwungen, in einen Bus zu steigen, der sie zur Polizeiwache bringen soll. Der Grund: ihr Hijab säße nicht nach islamischen Standards und sie verstoße so gegen iranische Sitten. Sie wird zur Polizeiwache gebracht, dort weiterhin geschlagen, ihre Schmerzen werden ignoriert. Der schließlich für sie gerufene Krankenwagen braucht fast eineinhalb Stunden von der Polizeiwache zum Kasra-Krankenhaus. Dort ist sie bereits klinisch tot und wird weitere zwei Tage künstlich am Leben gehalten. Am 16. September 2022, drei Tage später, wird sie im Krankenhaus offiziell für tot erklärt. Sie war 22 Jahre alt.
Mohammad Rasoulof, selbst Iraner und Regisseur aus Teheran, verarbeitet in seinem Film Die Saat des heiligen Feigenbaums die perfide Willkür der iranischen Polizei und des theokratischen Regimes im Iran. Ich erinnere mich, als wir im Kinosaal gesessen haben, im Zuge der Leipziger Filmkunst-Messe (meine erste Filmmesse) letzten September und darauf gewartet haben, dass wir diesen Film von unserer must-watch Liste streichen können. Ich erinnere mich auch daran, dass ich in den ersten 10 Minuten des Film schon weinen musste. „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ habe ich nicht für diesen Artikel ausgesucht, weil er künstlerisch besonders umwerfend ist oder weil er durch sein komplexes Drehbuch überzeugt hat, ich habe ihn ausgewählt, weil es ein Wunder ist, dass er überhaupt entstanden ist und mir, als zuschauender Person, gezeigt werden konnte.
Dass Mohammad Rasoulof bewusst diesen Film aus der Sicht der Betroffenen zeigt und sich nicht auf die Täter:innen in dieser Thematik fokussiert, beweist für mich, dass dieser Film für die Betroffenen, die Kämpfenden und die Wütenden gedreht wurde. Rasoulof bezieht ganz klar Stellung und provoziert die iranische Regierung. Dessen waren sich auch die Hauptdarsteller:innen bewusst. Die beiden Protagonist:innen, die die zwei Schwestern spielen, waren gezwungen nach dem Abschluss des Films ihr Heimatland zu verlassen. Das Familiensetting, in das die Handlung fällt, unterstützt für mich das Verständnis der sozialen Dynamiken in dieser Gesellschaft. Der Vater wird zum einflussreichen Regimefunktionär, genau in der Zeit, in der die Proteste ihre Hochphase erreicht haben. Die Familie wird hineingerissen in das Geschehen, da der Vater nun auch über Festnahmen und Hinrichtungen von Protestierenden entscheidet. Die beiden Schwestern fühlen sich gezwungen zu handeln im Sinne der Frauenrechte, doch stehen sie durch ihre Verhältnisse auf der gegnerischen Seite. Ein interner familiärer Konflikt entwickelt sich und erreicht seinen Höhepunkt in einem Kampf zwischen den Frauen der Familie und dem Vater.
Nachdem wir den Film geschaut hatten und ich tränenüberströmt aus dem Saal gehen wollte, wurde bekannt gegeben, dass es noch ein Q and A mit den zwei Protagonist:innen geben würde. Beide wohnten jetzt in Deutschland und waren bereit, ihre Geschichte zu teilen. Sie berichteten wie der Film gedreht wurde.
Sie erzählten davon, wie Mohammad Rasoulof ein geheimes Casting in Teheran veranstalten ließ, um Darstellende für seinen Film zu finden. Die beiden Protagonist:innen, schon Teil des aktivistischen Kollektivs, meldeten sich und waren bereit, die Konsequenzen zu tragen und Teil vom Cast zu werden. Ein weiteres Problem, das sich ergab, war, dass es Höchststrafen gibt für das öffentliche Filmen im Iran. Die Filmcrew war also gezwungen verdeckt zu Filmen, was sich als Schwierigkeit herausstellte, besonders in den Szenen mit fahrenden Autos und an vollen Orten. Einmal bestand, laut den Darsteller:innen, sogar die Angst, von einem Auto des Regimes verfolgt zu werden. Der Dreh musste dementsprechend heimlich durchgeführt werden und nur mit Personen, denen man vertrauen konnte. Letzteres ganz besonders auch, weil die Darstellenden ohne Hijab vor der Kamera standen.
Diese Umstände, gepaart mit dem Können der Darstellenden, sich die Heimlichkeit nicht anmerken zu lassen, der Handlung, die in einem absoluten Höhepunkt mündet, und dem Wagemut von Mohammad Rasoulof, machen diesen Film für mich zu dem wichtigsten Film 2024.
The Zone of Interest (Olli)
Ich habe mich des Öfteren gefragt ob man neue Filmklassiker überhaupt erkennen würde beim ersten Schauen. Seit The Zone of Interest weiß ich es nun. Während des Schauens hatte ich ein permanentes Unwohlsein und die Endszenen haben mich so stark ins Mark getroffen, dass ich nach dem Film 10 Minuten nicht wirklich ansprechbar war und nach 30 Minuten immernoch weiche Knie hatte. So eine physische Reaktion hat noch kein Film vorher bei mir ausgelöst.

Der Film erzählt das Familienleben des Rudolf Höß, dem Lagerkommandant des KZ Ausschwitz. Gezeigt wird das banale Alltagsleben des Vaters Höß, der unter Arbeitsstress leidet, eine Mutter, die sich um Haushalt und Garten kümmert (mittels Haushaltshilfen, wohlgemerkt) und ihren Kindern. Das Unerträgliche dabei: Ihr Grundstück grenzt mit dem Gartenzaun direkt an das Vernichtungslager und man muss sich als Zuschauende:r diesen Normalitätssimulationsversuch eines Familienidylls antun. Dieser unerträgliche Dauerzustand wird immer wieder durch Schreie von Lagerinsassen, Rauchschwaden des Krematoriums und Dampfschwaden der anfahrenden Deportationszüge durchbrochen, welche jedoch von den Figuren größtenteils ausgeblendet werden.
Es handelt sich um eine lose Buchverfilmung des gleichnamigen Romans von Martin Amis von 2014. Nach seinem letzten Langfilm Under the Skin hat Regisseur Jonathan Glazer fast 10 Jahre Vorbereitung in diesen Film gesteckt, in denen er in sich in Archive begeben und Historiker konsultiert hat. Ein paar Beispiele für die Detailsversessenheit Glazers: Teil der Vorbereitung war z.B. auch die Erstellung einer Tonbibliothek der typischen Lagergeräusche, wie Maschinenlärm, Stiefel, Schüsse und Schreie, chronologisch mit Zeugenberichten abgeglichen sowie deren genaue Lokalisation für eine realistische Entfernungslautstärke bestimmt, um sie realitätsgetreu im Film wiederzugeben. Die Dreharbeiten fanden größtenteils an Originalschauplätzen statt und das Haus der Familie Höß wurde extra komplett nachgebildet. Der Garten wurde bereits Monate vor Drehstart bepflanzt, damit die Blumen zum Drehzeitpunkt in voller Blüte stehen.
Glazer schafft mit The Zone of Interest eine wahrlich einzigartige Holocaustverfilmung. Statt aus Opfersicht zu erzählen, nimmt man eine distanzierte Beobachterrolle ein, um die Täter zu portraitieren. Die filmische Distanz wird durch ferngesteuerte Kameras im Haus erzeugt, diese observierende Position erlaubt es nicht, irgendeine Nähe zu den Charakteren aufzubauen. Dieser Kameraaufbau ermöglichte die Abwesenheit der Filmcrew vom Set und ein gleichzeitiges Drehen und somit zeitliches Überlappen von Szenen, was den Schauspielenden wiederum viel Improvisationsraum erlaubt hat. Sandra Hüller als Hedwig Höß spielt eine unglaublich fiese "Königin von Ausschwitz", jede kleinste Interaktion mit den polnischen Haushaltshilfen wird zu einem Bangen vor einem folgenschweren Ausraster. In ihrem Schauspielschatten kann Bubigesicht Christian Friedel in der Rolle des Rudolf Höß allenfalls eine solide Performance abliefern. Mich hat insbesondere die Wahl der Digitalkameraoptik für so einen historischen Stoff hart getroffen, weil die üblichen Schwarz/weiß- bis Sepiaaufnahmen aus der Nazizeit automatisch eine filmbildnerische Distanz aufbauen, wo ich als Zuschauer die Chance habe, mich zurückzulehnen und das als etwas bereits Vergangenes, fast schon Abgeschlossenes einzuordnen. Die digitalen Bilder von The Zone of Interest erzeugen jedoch eine zermürbende Aktualität, vor der man sich nicht wehren kann. Ich war dadurch viel mehr mit Gedanken über die Jetztzeit konfrontiert als bei anderen Holocaustfilmen.
Der Film ist so düster, dass Jonathan Glazer selber mehrfach kurz davor vor, das Projekt abzubrechen, die vorkommende Widerstandsgeschichte eines jungen Dorfmädchens brachte ihm jedoch einen Hoffungsschimmer, um weiter zu machen. Als jüdischer Filmemacher war es ihm besonders wichtig, den Holocaust nicht zu ästhetisieren, was sich durch den bewussten Verzicht auf zusätzliche Beleuchtung zeigt und durch die weitgehende Auslassung der von Mica Levi komponierten Filmmusik, welche nur im Pro- & Epilog vorkommt (dort dann aber sehr intensiv).
Die Idee des Films war es, eine Entmystifizierung des "beinahe mythologisch Bösen" zu schaffen. Da ich wahrscheinlich nie wieder auf einer Familienfeier Gesprächen über die hübsch blühenden Dahlien lauschen kann, ohne an diesen Film zu denken, würde ich das als Erfolg verbuchen. Danke dafür, Jonathan.
Definitiv mein Film des Jahres 2024 und vermutlich auch des Jahrzehnts.