Beats and Screens: „Last Christmas“ von Wham!
In der Special-Holiday-Ausgabe von Beats and Screens werfen wir uns mit Wham! ins Schneegestöber, um anschließend bei seichtem Kerzenschein über gebrochene Herzen und Margaret Thatcher zu schwadronieren.
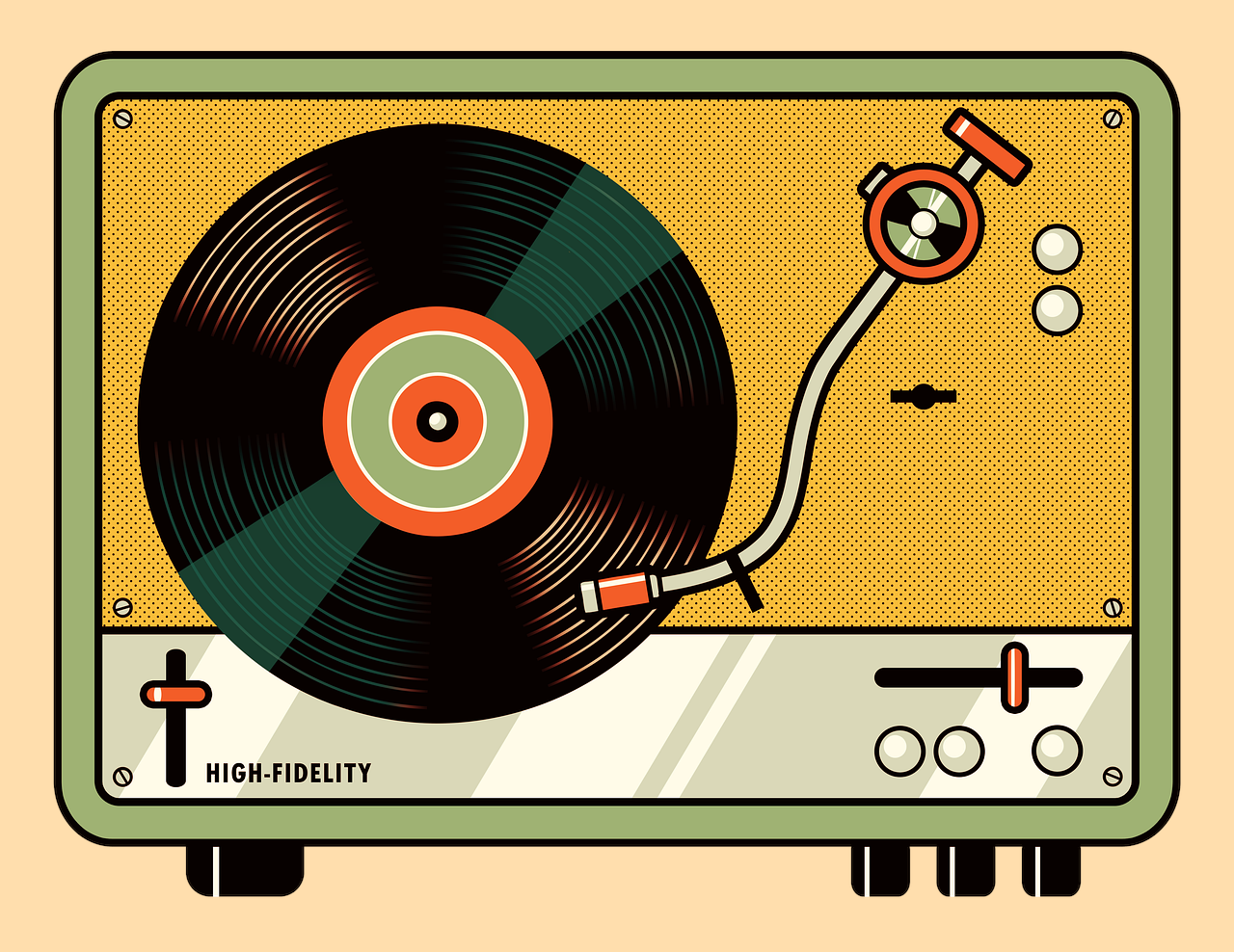
“Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away…”
Es war, wie so oft, ein Stechen zwischen zwei Möglichkeiten. Und wenngleich ich zu diesem heiligsten aller Feste, der Zelebrierung der Geburtsstunde des Coca-Cola-Eisbären, auch gut und gerne über Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ hätte sinnieren können, so hätte das letztendlich kaum Mehrwert für mich oder meine geneigte Leserschaft gehabt. Denn zum einen weiß ich schon genau, was ich mir zu Weihnachten wünsche – dass Papa Martin wieder anfängt, tolle Artikel für diesen Blog zu schreiben – und zum anderen suche ich in dieser Reihe immer neue Elemente, die ein Musikvideo bemerkenswert machen könnten. Und da fiel mir just ein: Hatte auch nur eines der bisher besprochenen Meisterwerke eine konkrete Handlung? Charaktere? Suspense? Ein flair très dramatique? Ich denke nein. Somit war klar, dass ich mir den anderen Einzelhandel-Albtraum der geweihten Nächte vorknöpfen muss, dessen Plot mich in ein schweizer Ski-Kitschparadies entführt und das von George Michael auf gebräunten, belastbaren Schultern getragen wird. Hier kann ich doch nur Erfolg bei meiner Suche haben, wird doch unserem liebsten George nachgesagt, selbst den Boden, auf dem er tanzte, rund 80 Prozent dramatischer zu machen, selbst wenn es sich um das abgelatschte PVC einer Studentenbude gehandelt haben sollte.
(Aus legalen Gründen stelle ich hiermit klar, dass nur ich derlei Gerüchte streue, aber ich streue sie aus Überzeugung!)
Also kommet an den Kamin, greift euch ein Heißgetränk, ein paar von Omis Keksen und eure Hausausgabe von Das Kapital (glaubt mir, es wird relevant werden) und folgt mir auf meinem Tauchgang durch die (Kokain ausgeklammert) dichtesten Schneegestöber der 1980er.
Vor dem Video
England, 1984, ein beschaulicher Sonntagabend: Es wird ferngesehen im Hause Panayiotou. Eltern Kyriacos und Lesley genießen solche Abende mit der Familie, an denen die beiden Töchter Melanie und Yioda sowie Nesthäkchen Georgios zum Essen kommen. Georgios, der sich inzwischen George nennt, hat sogar seinen besten Freund Andrew mitgebracht. Die beiden kennen sich, seit die Panayiotous einige Jahre zuvor in die Gegend um Bushey gezogen waren. An seinem ersten Schultag nimmt Andrew George sofort unter seine Fittiche. Die beiden haben viel gemeinsam: beide werden 1963 geboren, beide entstammen gemischtethnischen Verbindungen (englisch und italienisch-ägyptisch in Andrews, englisch und zyprisch in Michaels Fall) und beide träumen davon, Musiker zu werden.
Als pubertierende Jungspunde machen sie die Straßenmusiker-Hotspots unsicher und drücken jeder Pubbekanntschaft, die auch nur peripher mit dem Musikbusiness zu tun hat, ein Demotape in die Hand. 1982, die beiden sind inzwischen 19, fruchtet das endlich: Sie werden vom jungen Label Innerversion Records unter Vertrag genommen, das zunächst ihre Singles „Wham Rap (Enjoy What You Do)“ und „Club Tropicana“ herausbringt. Das Duo konzipiert sich als unbeschwert und freiheitsliebend; Während ihre Anfänge als Ska-Band bald im Staub der Vergangenheit verschwinden, bleiben sie unter dem Moniker Wham! ihren sozialkritischen Neigungen treu und besingen (und berappen) das Leben auf Staates Nacken, das Singledasein und Partys. Ihr Debütalbum „Fantastic“ erntet gute Kritiken, ein Auftritt bei Top of the Pops etabliert sie für eine Fangemeinde, die George (inzwischen George Michael) gerne mit Lederjacke und nacktem Oberkörper sieht. Als das Label anfängt, seltsame Vermarktungsstrategien wie Compilations zu verwenden, nutzt das Duo die Gelegenheit zum Absprung. Ihr neues Zuhause wird Epic Records.
Aber zurück zum Wohnzimmer der Panayiotous. Zwischen dem Snacken fällt Andrew auf, dass George sich schon seit einer Weile aus ihrer gemütlichen Mitte absentiert hat. Kurze Zeit später taucht er jedoch wieder auf, mit einem Gesichtsausdruck, der mit goldiger Beseeltheit noch gemäßigt umschrieben ist. Die beiden Freunde ziehen sich in Georges ehemaliges Kinderzimmer zurück, in dem sie früher stundenlang Radiosendungen aufgenommen und auf dem Keyboard geklimpert haben. Und George spielt Andrew das Intro zu einem Song vor, den er schon lange versucht, zu schreiben – den Weihnachtssong. Später wird Andrew Ridgeley über diesen Moment sagen: „It was a moment of wonder. George had performed musical alchemy, distilling the essence of Christmas into music.”. Jetzt musste die Essenz von Weihnachten nur noch produziert, aufgenommen und visuell bespielt werden.
Das Video
Schwenk über eine beschauliche Berglandschaft. Dicker Schnee überzieht das Setting, selbst die vereinzelten Bäume sehen aus, als würden sie frieren. Eine Gruppe junger Freund:innen, die yuppiehafter aussieht als der junge Robert Downey Jr., hat sich am Fuße eines Skilifts zusammengefunden, um gemeinsam ein kuschliges Weihnachtsfest in einem Chalet zu verbringen. Wir hoffen auf einen Slashertwist, durch den sie alle der Reihe nach von einem maskierten Unbekannten à la Iced abgemeuchelt werden, aber wir werden enttäuscht. Tatsächlich stirbt in dieser Handlung nur eines, und das ist die Romanze zwischen George Michael (der sich vor dem Trip anscheinend am Strähnchen-Blondierungs-Set von DM gütlich getan hat) und einer brünetten Dame, deren Charakterisierung mit roter Garderobe und passendem Lippenstift beginnt und endet. Wir folgen der Truppe, wie sie ihr Gepäck zu ihrem Domizil befördert und die Räumlichkeiten dekoriert. Nur Gott und Regisseur Andrew Morahan wissen, warum diese Deko eine Decke in Leopardenprint und an die Wand genagelte Schafsfelle beinhaltet. Anschließend wird im Schnee gespielt und abends festlich diniert.
Immer wieder kreuzen sich dabei die Blicke von George Michael und der Lady in Red, die Aura von Nachdenklichkeit und Unausgesprochenem hängt zwischen ihnen. Vereinzelte Rückblenden zeigen das Paar in glücklicheren Zeiten (letztes Weihnachten), aber nun (dieses Weihnachten) gilt ihre Gunst – Schreck, Skandal! – Wham!-Kollegen Andrew Ridgeley. Unsere Aufmerksamkeit wird auf eine Brosche gelenkt, die ganz dreist von der Dame an Ridgeley weiterverschenkt wurde. Im warmen Kaminschein frönt man eine Weile lang dieser Erinnerungen, doch als die Truppe am nächsten Morgen aufbricht, scheint unser Protagonist seinen Frieden mit dieser Erfahrung gemacht zu haben. Sein Arm schlängelt sich schon um eine andere junge Frau, bei deren Mangel an Persönlichkeit sein Herz bestimmt sicher ist. Es bleibt unklar, ob seine alte Flamme mit ihrer Wahl so glücklich ist; Ridgeleys affektioniertes Gehabe scheint sie nicht sonderlich zu beeindrucken. Aber jeder andere verfügbare Topf im Chalet hat gegen Ende hin seinen Deckel gefunden, demnach ist dieser Drops gelutscht und sowieso sollte man sich von Reue weder Weihnachten noch Skiurlaub versauen lassen.
Was ist denn nun dran an dem Video?
Ich persönlich erwarte mir von einem Musikvideo mit Handlung genau zwei Varianten: Entweder, das Video ist eine passgenaue Reflektion des Songs, sei es in Text, Atmosphäre oder Thematik. Oder aber die Handlung ist, und das ist ein Fachterminus, absolut bonkers. So unglaublich inkohärent, zusammenhanglos und vom Grundprodukt losgelöst, dass man in etwa so lange davorsitzt wie vor einem frisch hingeniesten Pollock und sich fragt, warum man es so liebt, ohne es zu verstehen. Bei „Last Christmas“ treffen wir zweifelsohne Variante 1 an: Der Song handelt von einer Ex-Flamme, die infam auf den Gefühlen unseres lyrischen Ichs herumgetrampelt hat – und das zu Weihnachten! Lo and behold: Das Musikvideo zeigt uns genau das, gemeinsam mit allem, was wir mit den Konzepten Weihnachten und enttäuschter Leidenschaft verbinden. Schnee! Lametta! Essen! Rot! Hübsche Funkelsteine! George Michael! (ihr dürft entscheiden, was zu was gehört.) Ich bin mir sicher, das Video zu „Last Christmas“ schon in meinem Kopf gemalt zu haben, bevor ich es je zum ersten Mal sah.
Und wo wir schon bei der transzendentalen Wohligkeit erfüllter Erwartungen sind: Gleichzeitig fungiert dieser Clip auch als famose Inszenierung von Wham!s Image, das Michael und Ridgeley zu Anfang der Epic-Ära anstreben: Zwei Pop-Prinzen, die immer noch gerne Spaß haben, aber inzwischen in polierteren Kreisen. Schluss ist's mit dem Rap und den Graffitisprüchen am Arbeitsamt, ab jetzt heißt’s Skiurlaub im schweizerischen Saas-Fee bei einem guten Wein. Aus ist’s mit wildem Bachelordasein, ab jetzt heißt’s Monogamie, aber in hetero und gutbürgerlich! Tatsächlich öffnet uns „Last Christmas“ nicht nur eine Tür in spießigste Feiertagsfantasien, sondern auch in die englische musikpolitische Sphäre der 1980er.
Also lasst uns über die Klassenpolitik von Wham! reden.
(Hier eine Notiz an meine Liebsten: Wenn der vorherige Satz nicht mein Epitaph wird, ist mein Vermächtnis bedeutungslos.)
Denn tatsächlich ist da ein Schatten, der Wham! auf ihrem Weg an die Spitze der Charts verfolgt, und sein Name ist Thatcherismus. Ganz vereinfacht ausgedrückt: In den 1980ern stand Großbritannien unter der sozialpolitischen Fuchtel von Premierministerin Margaret Thatcher. Ja, das ist die Lady, nach deren Tod in England massenweise „Ding Dong, the Witch is Dead“ aus den Fenstern schallte. Thatcher hatte einen recht simplistischen Blick auf die britische Arbeiterklasse: Wer sich nicht aus eigener Kraft aus dem Prekariat schaufelte, der war natürlich ein Sozialschmarotzer. Ergo sollte ihrer Ansicht nach der Staat nicht mit Almosen um sich schmeißen, ganz besonders nicht, wenn es um faule Migranten ging. Mit ihren bescheidenen, multikulturellen Backgrounds und ihrem gar sozialistischen Frühwerk hätte das Wham! zu natürlichen Feinden des Thatcherismus machen sollen.
Das Problem war nur, dass sie einfach zu glossy aussahen und zu viel Spaß hatten. In dem Artikel „Why Wham! were positively the most misunderstood group of the 1980s“, veröffentlicht in The Guardian, schreibt Musikjournalist Bob Stanley:
„Their second album was called Make It Big, and the imperative title alone seemed to cement an “if you can’t beat them, join them” embrace of excess and empire building”
Wham!s hyperpositive, zuckersüße Sonnenschein-Attitüde schlägt sich schlecht beim schlichten Volk, zu dem sie ursprünglich gehört hatten. Bei einem Auftritt im September 1984 in der London’s Royal Festival Hall will das Doppelgespann Solidarität mit den streikenden Minenarbeitern ausdrücken, diese lässt das aber kälter als den traditionellen Kartoffelsalat. Andere Bands der Zeit mit ähnlichem Bestreben inszenieren sich einfach anders. Man nehme zum Beispiel das Video zu „Don’t Leave Me This Way“ von den Communards und Sarah Jane Morris. Hier trifft man sich noch im Untergrund, alle sind arm, traurig und wütend, wie’s sich gehört, hier trägt niemand schicke Wintermäntel und teure Broschen, hier rebelliert man in Turnschuhen und prangert den Staat durch Lagerhallen-Kulturterrorismus an! Auch das ist tanzbar, aber gleichzeitig identifikationstüchtiger als ein Luxus-Skiurlaub mit der in Markenklamotten eingezwiebelten Clique. Und wenn euer erster Gedanke jetzt ist „Na so teuer ist Skiurlaub jetzt auch nicht, einmal im Jahr geht das schon.“, dann gratuliere ich zum gesunden Mittelstand. Und das meine ich mit nur einem Minimum an Verbitterung.
Das Video der Communards dreht Duncan Gibbins, der zufällig auch mit Wham! arbeitet, etwa für das bereits erwähnte „Club Tropicana“ und „Careless Whisper“. Wie kann derselbe Mann für zwei sozialistisch geprägte Bands arbeiten, aber eine wird zum Flagschiff anti-thatcheristischen Aufbegehrens und die andere wird die frischpolierte Marmorstatue des Klassenverrats? Und hier enden nicht einmal die Gemeinsamkeiten: Während die Homosexualität des Communards-Frontmannes Jimmy Sommerville zwar unverblümt nach außen kommuniziert wird, wirkt dies bei George Michael in jeder Hinsicht unfreiwillig, handelt es sich bei „Last Christmas“ doch um ein auf dem Papier heterosexuelles Produkt. Aber ich verweise noch einmal nach oben auf das Bild von Michael, mit kokettierendem Blick und affektierter Handhaltung. Sicher, Äußerlichkeiten sind Schall und Rauch, aber Jimmy Sommerville singt im einfachen Hemd über Unterdrückung. George Michael singt in Booty-Shorts über Doris Day. Und während er gegenüber Andrew Ridgeley bereits 1982 bekundet, zumindest bisexuell zu sein, schiebt er ein öffentliches Coming-Out bis 1998 auf.
Die 1980er sind in England neben Thatcherismus auch von der AIDS-Krise und der Clause 28, die Erwähnungen von Queerness im Schulen verbietet, geprägt. Zweifelsohne haben weder Sommerville noch Michael es in diesem Klima leicht. Homophobie ist bis heute virulent in allen Gesellschaftsschichten (ich wiederhole, allen), aber das Proletariat ist ein komplexes Sammelsurium an bizarren Verhaltensregeln. Und abstruserweise ist es gerade in dieser Bevölkerungsschicht nicht unbedingt populär, queer zu sein, es sei denn, man lässt es nicht so raushängen, hat aber gleichzeitig genug Arsch in der zerwetzten Jeans, um es zuzugeben. Zumindest sagen das meine jahrelangen Recherchen zu dem Thema. Beides war bei Michael eher weniger der Fall, und es dürfte ihn nicht nur bei Minenarbeitern Sympathiepunkte gekostet haben.
Wir können es uns also bequem machen und das Video zu „Last Christmas“ als verklärte Heiligabend-Fantasie in den Alpen akzeptieren. Oder wir schauen hinter George Michaels fluffige Föhnfrisur und erkennen die Selbstdarstellung einer Band, die mit ihrer Identität und ihrem Image ringt. Seit Jahrzehnten entscheidet sich die Frage, wie viel man diesem Song abgewinnen kann, von dem Maß an Positivität, das man zu ertragen gewillt ist. Und da das höchstpersönlich ist, kann ich niemandem diese Entscheidung abnehmen.
Mal abgesehen davon, feliz navidad und so. Ich hätte ja den beleuchteten Tannenbaum rausgeholt, aber die Inflation kickt und ich kann mir weder die Stromrechnung noch eine Tanne leisten.
In diesem Sinne:
Fakten für die nächste Gartenparty
· Das bereits erwähnte zweite Album „Make it Big“ brachte die Singles „Wake Me Up Before You Go-Go“, „Freedom” und „Careless Whisper” hervor. So viele bahnbrechende Hits sollten legal verboten sein. Noel Gallagher pflegte (zurecht) in Interviews zu sagen „Natürlich bin ich arrogant – ich habe „Wonderwall“ geschrieben und ihr nicht.“. Ich weiß nicht, ob George Michael arrogant war. Verdient hätte er’s.
· Andrew Morahan schenkte uns nicht nur dieses Musikvideo, sondern auch den Film Highlander III: The Sorcerer. Wir verdanken ihm ebenfalls Collaborationen mit den Pet Shop Boys („West End Girls“), den Communards („So Cold the Night“), Spandau Ballet („Be Free With Your Love”) und The Human League („Human”, einem persönlichen Favoriten von mir). Ich nehme stark an, dass Monahan mit diesem Output in jeder queeren Bar weltweit aufs Haus trinkt.
· Die wanderlustige Exfreundin wurde von Model Kathy Hill gespielt – an ihrem Auftritt hier sowie einer Barcadi-Werbekampagne verdient sie bis heute. Wham!-Background-Sängerinnen Pepsie & Shirlie sowie Martin Kemp, Bassist von Spandau Ballet, treten ebenfalls auf.
· Die beim Dreh verwendete Brosche gehörte Andrew Ridgeleys Mutter und ging selbstverständlich verloren. Nach panischer Suchaktion wurde sie letztendlich wieder aus dem Schneegestöber gefischt.
· Das Projekt zielte auf die Bekämpfung der Hungersnot in Äthiopien ab, weshalb sämtliche Songerlöse für den guten Zweck gespendet wurden. Nachdem der Dreh zu „Last Christmas“ beendet war, hopste Michael direkt in ein Taxi, um einen weiteren Charity-Song aufzunehmen. Es handelt sich dabei um „Do They Know It’s Christmas“ von Band Aid – den einzigen Weihnachtssong, der in Großbritannien höher in den Charts rangiert als „Last Christmas“.
· Notorischerweise verstarb George Michael just an Weihnachten 2016 im Alter von nur 53 Jahren. Tatsächlich war es für ihn selten eine schöne Zeit: Sowohl seine eigenen Suchtprobleme, als auch gesundheitliche Beschwerden seiner Mutter und einer seiner Schwestern sowie die HIV-Erkrankung und der Tod seines Partners Anselmo Feleppa hielten ihn öfter über die Feiertage im Krankenhaus. In der Folge entwickelte er eine unverkennbare Affektion gegenüber Krankenschwestern. Bereits zu Lebzeiten kam medizinisches Personal kostenlos auf seine Konzerte. Nach seinem Tod wurde bekannt, dass der Sänger regelmäßig beachtliche Beträge für zahlreiche medizinische Organisationen zu spenden pflegte.
Man kann sein Werk verteufeln oder verehren, aber der Mann hatte viel Herz – wahrscheinlich, weil er’s nicht mehr unüberlegt am Heiligabend verschenkt hat.
Mit glühendstem Dank an den talentierten Leo Schimmank, der, wenn er mein Zeug nicht prüfen muss, super tolle eigene Sachen schreibt.

